„In manchen Monaten verdiene ich 50 Euro“ – wie prekär ist Plattformarbeit?

Nadine und Antonia arbeiten als Clickworkerinnen – über sogenannte Mikrojobs trainieren sie Suchmaschinen oder Künstliche Intelligenz, indem sie ihre Leistung bewerten. Die Bezahlung dafür variiert stark – mal kann es für einen Auftrag 100 Euro geben, mal 7 Cent. Die spontanen Aufträge bieten zwar flexible Arbeitszeiten, können jedoch prekäre Arbeitsverhältnisse verstärken. AufRuhr hat die beiden Frauen bei ihrer Arbeit begleitet.
Dass im Internet alles rundläuft, ist der Arbeit vieler Menschen zu verdanken: von Programmier*innen, Entwickler*innen oder Grafiker*innen. Ein wichtiger Teil der Arbeitskette bleibt jedoch unsichtbar: die Clickworker*innen und Crowdworker*innen. Sie trainieren unter anderem Algorithmen und Künstliche Intelligenz (KI), indem sie die Leistungen solcher Anwendungen bewerten und sie damit besser machen. Sie sind als Freelancer*innen tätig und bearbeiten Tag für Tag Aufträge von Plattformen wie Clickworker, Fiverr oder Amazon Mechanical Turk. Laut neuen Studien des Forschungsprojektes „Chancengerechte Plattformarbeit“ von Minor – Projektkontor für Bildung und Forschung sind die Arbeitsbedingungen der sogenannten Plattformarbeit oft prekär. Diese freiberuflichen Tätigkeiten versprechen zwar große Flexibilität, bieten allerdings kaum soziale und arbeitsrechtliche Absicherung.
AufRuhr hat zwei Clickworkerinnen begleitet, um mehr über den Alltag der Plattformarbeit zu erfahren.
„Du hast kaum Sicherheit“
Wenn Nadine (Name geändert) ihren Arbeitstag beginnt, ist es früh am Morgen. Die 52-Jährige fährt ihren PC hoch, ihr rot getigerter Kater Kasimir spielt währenddessen mit dem Ladekabel. Nadine arbeitet hauptberuflich als Clickworkerin, seitdem sie aus gesundheitlichen Gründen keinen Job auf dem regulären Arbeitsmarkt finden konnte. Ihre Aufgaben als Freelancerin sind unterschiedlich: Mal fertigt sie Sprachaufnahmen an, ein anderes Mal beurteilt sie Audioaufnahmen danach, ob sie künstlich oder menschlich klingen. Oft nimmt Nadine an Umfragen teil, die von Forschungseinrichtungen und Studierenden in Auftrag gegeben werden.

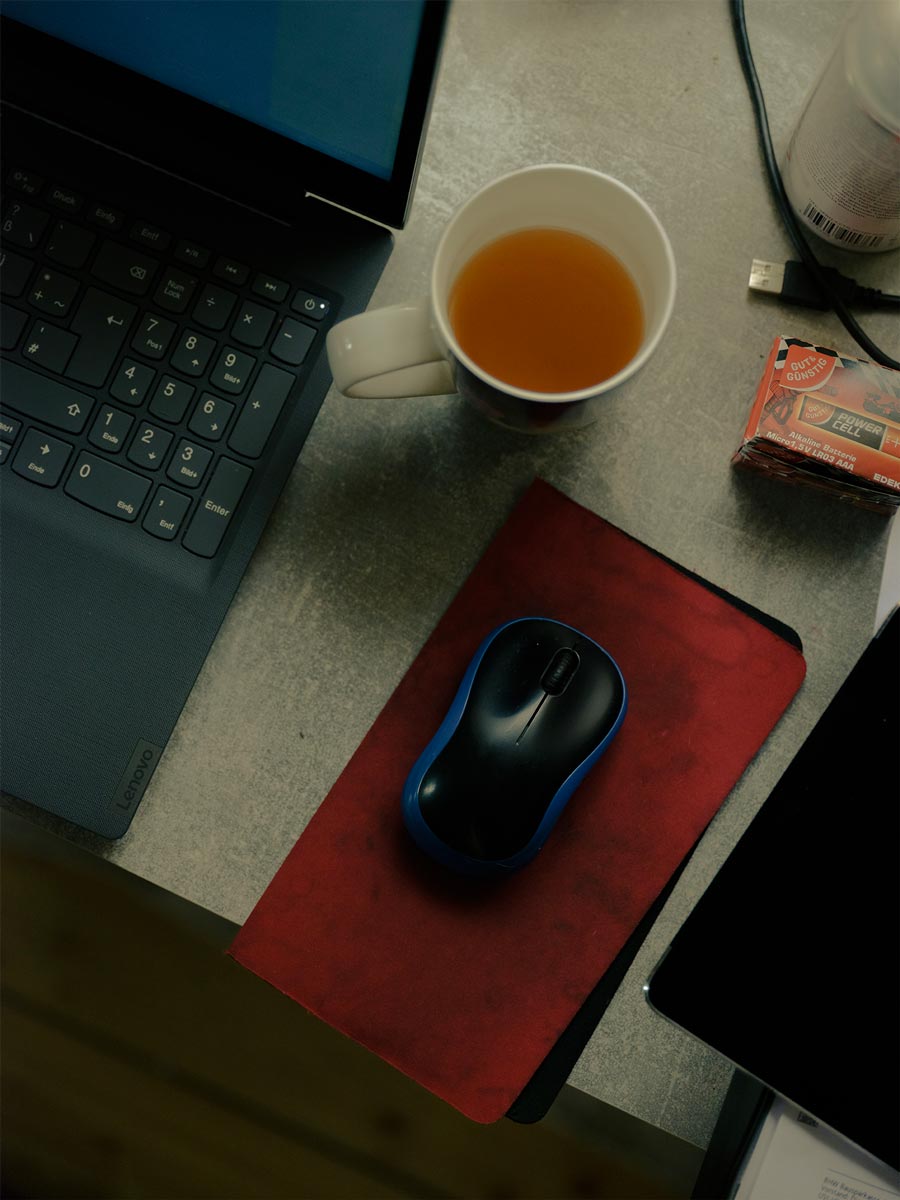
An manchen Tagen kommt sie vor lauter Aufgaben nicht hinterher, an anderen wiederum klickt sie sich vergeblich durch die sieben Clickwork-Plattformen auf der Suche nach Aufträgen. „In den letzten Jahren ist es weniger geworden, sowohl an Aufträgen als auch an Bezahlung“, berichtet Nadine. Die Anzahl an verfügbaren Aufträgen variiert stark – Planbarkeit gibt es für Clickworker*innen nicht wirklich. „Es gibt Monate, in denen ich 50 Euro verdiene, und Monate, in denen ich 300 Euro verdiene“, erzählt die 52-Jährige. „Du hast keine Sicherheit.“
Warum die Arbeitsbedingungen der Plattformökonomie oftmals prekär sind, weiß Anna-Elisabeth Hampel. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „Chancengerechte Plattformarbeit“ von Minor. Der Projektkontor für Bildung und Forschung untersucht die Arbeitsbedingungen der Plattformarbeit. „Es gibt kaum langfristig planbare Löhne, hohe Konkurrenz um Aufträge, fehlende soziale Sicherung, meist einseitige Bewertungssysteme, ein undurchschaubares algorithmisches Management, und es mangelt an Möglichkeiten zum sozialen Austausch und zur professionellen Weiterentwicklung“, sagt Hampel.
Weil die Bezahlung und die Verfügbarkeit von Aufträgen so schwer planbar sind, haben Clickworker*innen meist keine andere Wahl, als den ganzen Tag vor dem PC zu verbringen und nach neuen Aufträgen zu suchen. Nadine arbeitet manchmal bis in die Nacht, oft am Wochenende oder an Feiertagen. Es könnte ja sein, dass ein neuer Auftrag ausgeschrieben wird – und den möchte sie nicht verpassen: „70 Prozent der Zeit verbringe ich mit Suchen, 30 Prozent der Zeit verdiene ich wirklich Geld“, sagt Nadine. Sie berichtet, dass sie seit Anfang dieses Jahres bis Mitte März 1.029 Euro durch Clickwork verdient habe. Mit Clickwork allein kann sie sich ihren Lebensunterhalt kaum finanzieren.
Über Social Media auf Clickwork gestoßen
Auch Antonia (Name geändert) ist Clickworkerin. Sie hat während der Pandemie mit Crowdwork – einer Art des Clickworks – angefangen, als sie über Social Media darauf aufmerksam wurde. Click- und Crowdwork werden oft synonym verwendet, doch es gibt Unterschiede. Anders als beim klassischen Clickwork bearbeiten Crowdworker*innen meistens Aufträge, die umfangreicher sind und mehr Qualifikationen voraussetzen. Die 39-Jährige ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern im Alter von zehn und zwölf Jahren und hat zuvor im Einzelhandel gearbeitet. Nachdem sie sich mehrere Jahre der Erziehung ihrer Kinder gewidmet hatte, hat sie kaum noch Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Hat sie morgens ihre Kinder für die Schule fertig gemacht, setzt sie sich an den Computer und schaut nach Aufträgen. Wenn mal nicht so viel los sei, erledige sie ihre Einkäufe oder kümmere sich um den Haushalt, sagt Antonia.

Die hohe Flexibilität sei einer der wichtigsten Gründe, warum Menschen in die Plattformarbeit einstiegen, meint auch Anna-Elisabeth Hampel: „Das Modell verspricht zeitliche und örtliche Flexibilität. Es gibt auch keine langwierigen Bewerbungsprozesse. Dadurch bietet sich Plattformarbeit für Menschen an, deren Zugangsmöglichkeiten zum regulären Arbeitsmarkt eingeschränkt sind. Je stärker Menschen für ihren Lebensunterhalt auf Plattformarbeit angewiesen sind, desto mehr geht jedoch die Flexibilität verloren, weil sie ständig verfügbar sein müssen.“
Mal spricht Antonia Texte für die Entwicklung von KI ein, mal beurteilt sie die Ergebnisse von Suchmaschinen und hilft so, deren Funktionsweise zu optimieren. In letzter Zeit sei zu den typischen Clickwork-Aufgaben noch Game Testing dazugekommen, sagt Antonia. Manchmal gibt es allerdings auch Aufträge, die nicht zwangsweise am Computer erledigt werden müssen – zum Beispiel, wenn Firmen sie Produkte wie Shampoo oder Süßigkeiten testen lassen. Gerade über Letzteres freuen sich Antonias Kinder sehr.
„In Gedanken ist man immer beim Job“
Als Crowdworkerin verdient Antonia in der Regel 600 bis 700 Euro im Monat. Sie erzählt, dass sie damit über die Runden komme – zumal sie auch Wohngeld, Unterhalt und Kindergeld erhalte. „Ich habe gelernt, smart hauszuhalten“, sagt die 39-Jährige. Genauso wie Nadine sitzt Antonia von morgens bis abends vor dem PC, um gut bezahlte Aufträge nicht zu verpassen. Mit Familie und Arbeit bleibt Antonia am Ende des Tages nicht viel Zeit für andere Dinge. Wenn sie sich dann doch mal mit Bekannten trifft, ist sie oft gedanklich bei der Arbeit. „Du denkst dir dann: Das ist jetzt Geld, das dir eigentlich fehlt“, sagt Antonia.
Mehr Mitbestimmung bei der Plattformarbeit


Trotz des Fortschritts von KI ist die Zuarbeit von Menschen auch in absehbarer Zukunft unverzichtbar. Deshalb sei es umso wichtiger, sich verstärkt für die Rechte von Plattformarbeiter*innen stark zu machen, findet Anna-Elisabeth Hampel von Minor. Mitbestimmungsrechte für analoge Berufsfelder seien bisher schlecht an die Arbeitsverhältnisse im digitalen Raum angepasst sowie die Rechts- und Sozialschutzsysteme von Selbstständigen und die Mitbestimmungsrechte in digitalen Arbeitsverhältnissen nicht deckungsgleich: „Selbstständige Plattformarbeiter*innen müssen besser in unsere Rechts- und Sozialschutzsysteme integriert werden.“ Zwar hat die EU gerade eine Richtlinie zur Plattformarbeit beschlossen. Ob diese die Arbeitsbedingungen der Plattformarbeit wirksam verbessert und weitere Regelungen erarbeitet werden, bleibt abzuwarten. Die Studien zur chancengerechten Plattformarbeit bilden schon heute eine wissenschaftliche Grundlage, um die Arbeitsverhältnisse von Plattformarbeiter*innen wie Antonia und Nadine nachhaltig zu verbessern.
In unseren FAQ beantworten Anna-Elisabeth Hampel und Franziska Loschert, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen bei der Studie „Neue Formen, Akteure und Koalitionen der Interessensvertretung in der Plattformarbeit“, die wichtigsten Fragen rund um Clickwork.
Chancengerechte Plattformarbeit
Faire Teilhabe von Plattformbeschäftigten entwickeln
Das Projekt nimmt den Arbeitsmarkt der Plattformökonomie als Gesamtsystem und die Teilhabechancen von Plattformarbeiter*innen anhand verschiedener Forschungsansätze in den Blick. Es bringt Akteur*innen aus Plattformökonomie, Politik und Wissenschaft in den Austausch und stellt eigene Analysen und Forschungen an.
Mehr Informationen und Erkenntnisse aus der aktuellen Studie des Projektes finden Sie hier: https://minor-kontor.de/interessensvertretung-in-der-plattformarmarbeit/
