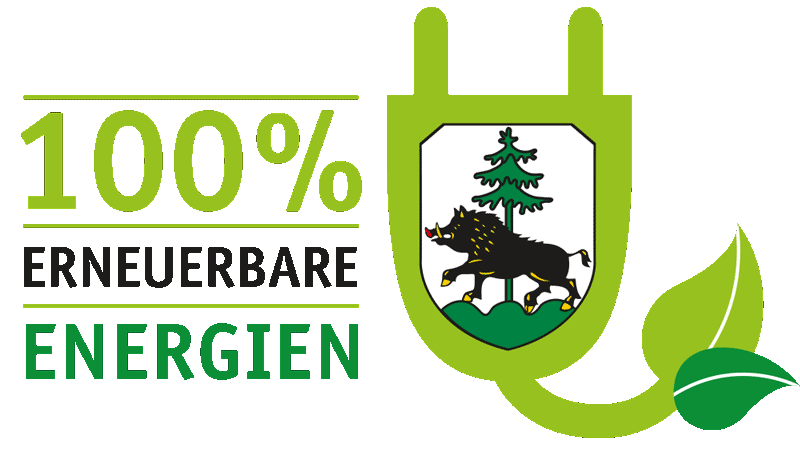Einmischen erwünscht

Nur ein einziges Windrad dreht sich im Landkreis Ebersberg bei München. Trotzdem möchte die Region bis 2030 klimaneutral werden. Wie kann das funktionieren? Zehn Ebersberger*innen ließen sich darauf ein, die Potenziale der Windkraft für ihre Heimat zu ergründen und der Bevölkerung schmackhaft zu machen.
Ebersberg im gleichnamigen Landkreis im September 2020: In dem kleinen Städtchen mit Rokoko-Wallfahrtskirche und schneeweißem Rathaus treffen sich zehn Einheimische in einer Gaststätte. Das jüngste Mitglied der Gruppe ist 20, das älteste 59 Jahre alt. Sie alle nehmen teil an dem Projekt „Aktiv BüKE “: Die Abkürzung steht für „Aktive Bürgerexpert*innen für Klimawandel und Energiewende im Landkreis Ebersberg“. „Ich hatte mich vorher schon mit Nachhaltigkeit beschäftigt“, sagt die 26-jährige Lea Steiner, die in Ebersberg aufgewachsen ist und im ausgebauten Dachgeschoss im Haus ihrer Eltern lebt. „Trotzdem war ich am Anfang völlig planlos, was uns erwartet.“ „Mir ging es genauso“, bestätigt Florian Blacha, 22. „Wir waren ja alle Lai*innen und bunt zusammengewürfelt. Aber es war gut zu wissen, dass wir in dem kommenden halben Jahr ein gemeinsames Ziel vor Augen haben.“ Am Ende sollte ein Plan stehen, wie der Landkreis bis 2030 seinen Strombedarf bilanziell selbst über erneuerbare Energien decken kann.


Konzept zur Energiewende von engagierten Lai*innen
Aktiv BüKE geht auf eine Initiative der Deutschen Umwelthilfe (DUH), der Medical School Hamburg (MSH) und der Technischen Universität München zurück. Das Projekt möchte vor allem jüngere Menschen zur aktiven Teilhabe an der aktuellen Klimapolitik ermutigen – und zwar als sogenannte Citizen Scientists. Also als Bürgerwissenschaftler*innen, die mit Neugier und Engagement ein Thema so vorantreiben, dass Politik und Wissenschaft davon profitieren. Es gibt solche Projekte in jeglichen Fachrichtungen. Das Robert Koch-Institut wertet zum Beispiel im „GrippeWeb“ anhand gespendeter Daten von Bürger*innen das Aufkommen von Erkältungserkrankungen aus. Bei „Blitzortung.org“ dokumentieren Lai*innen, die sich fortgebildet haben und die von Wissenschaftler*innen unterstützt werden, elektromagnetische Wellen und schicken ihre Blitzdaten an Wetterdienste, Energieversorgungsunternehmen, Versicherungen und andere Sachverständige, die sie auswerten und damit arbeiten.
In Ebersberg wurde den Aktiv-BüKE-Teilnehmenden in verschiedenen Informationsveranstaltungen zunächst Basiswissen zur Energiewende vermittelt. Genauso zu anderen Bereichen wie dem Bauplanungsrecht, das etwa bei der Installation von Anlagen zur regenerativen Stromgewinnung wichtig ist. In der konkreten Planungsphase wurden sie begleitet von Wissenschaftler*innen der Technischen Universität München, der Medical School Hamburg sowie des Fraunhofer-Instituts für Graphische Datenverarbeitung. Nach dem ersten Treffen in Präsenz fanden pandemiebedingt alle weiteren Veranstaltungen online statt. „Und das war gut so!“, ist Florian Blacha überzeugt. „Denn wir hatten unendlich viele Fragen: Welche Möglichkeiten haben wir, erneuerbaren Strom zu produzieren? Wollen wir Wind- oder Sonnenenergie nutzen? Wie viel Wind- und Sonnenenergie wird nötig sein? Was sind Vor- und Nachteile von Biogas? Wo dürfen überhaupt Windräder oder Photovoltaikanlagen aufgestellt werden? Aus den ursprünglich acht Workshops sind viel mehr Termine geworden, und online war das kein Problem.“


Das Leben vor der eigenen Haustür beeinflussen
Lea Steiner ist Vermessungsingenieurin und studiert außerdem Geografie in München. Sie hat sich bereits als Jugendliche für Nachhaltigkeit engagiert – mit vegetarischer Ernährung und einem weitgehend plastikfrei gestalteten Alltag. Doch damit stieß sie irgendwann an ihre Grenzen. „Das eigene Umdenken, der eigene Verzicht helfen vielleicht, das Mindset einer Gesellschaft ein Stück weit zu verändern“, sagt sie. „Aber ich hatte immer das Gefühl, dass es kaum Auswirkungen hat. Dass der Flug, den ich nicht antrete, später nicht messbar sein wird. An Aktiv BüKE hat mich gereizt, erstmals selbst politisch aktiv zu werden und einen größeren Hebel als mein eigenes Verhalten in der Hand zu halten.“
Ähnlich ging es Florian Blacha. Seine Eltern, die regelmäßig das Greenpeace-Magazin lasen, prägten ihn. Als er sich in der vierten Klasse mit der Abholzung des Regenwalds beschäftigte, war er maximal schockiert. „‚Warum macht denn niemand was dagegen?‘ Diese Frage habe ich mir immer wieder gestellt und als Kind keine Antwort gefunden. Ich habe dann privat gemacht, was ich konnte, unter anderem versucht, plastikfrei zu leben, was alles andere als ein triviales Unterfangen ist“, erzählt der Maschinenbaustudent. Aber genau wie Lea hatte er den Eindruck, dass es vielleicht sinnvoller wäre, seine Energie in ein größeres Vorhaben zu stecken und damit mehr zu erreichen.

Florian, Lea und ihre Mitstreiter*innen sollten während der Laufzeit des Aktiv-BüKE-Projekts festlegen, wie die Menschen in ihrem Landkreis mit Strom aus erneuerbarer Energie versorgt werden. Dafür „befüllten“ sie ein 3-D-Modell des Ebersberger Landkreises, erstellt vom Fraunhofer Institut für Grafische Datenverarbeitung, mit Windrändern und Photovoltaik-Anlagen. Und sie sollten mit anderen über Umweltschutz ins Gespräch kommen – mit Eltern, Freund*innen, Kommiliton*innen, Kolleg*innen, Nachbar*innen und Journalist*innen. Eine Art Graswurzelbewegung vor der eigenen Haustür.
Sind Sonnenkollektoren schön oder hässlich?
In der genauen Planung des Strombedarfs konnten die Bürger*innen auf einen bereits vorliegenden Meilensteinplan zurückgreifen, den eine Energieagentur aus dem Landkreis erstellt hatte. Dieser geht von 702 Gigawattstunden Stromverbrauch im Jahr 2030 aus. Dafür wären unter anderem mindestens 26 Windanlagen nötig. Zusätzlich Sonnenkollektoren, die sich auf 27.000 Dächern und 290 Hektar Freifläche verteilen. Darüber, wo die Energieanlagen aufgestellt werden, damit sie sich gut ins Landschaftsbild einfügen, gab es zahlreiche Diskussionen. Schließlich setzte sich die Idee durch, die Solarzellen wie Bänder entlang von Bahngleisen, einer Bundesstraße und einer Autobahn zu verlegen. „Mir erschien das auf Anhieb sinnvoll, weil man eine bestehende Infrastruktur nutzt und einfach verbreitert“, erzählt Lea Steiner. „Aber in den Schulungen wurde klar, dass man das auch ganz anders sehen kann. Denn indem man bestimmte Gegenden weiter bebaut und andere frei hält, wertet man die Region je nachdem auf oder ab.“ Florian Blacha ergänzt: „Außerdem sagt die Überlegung ‚An der Autobahn stören die Solaranlagen am wenigsten’ viel über den Stellenwert von regenerativem Strom in der öffentlichen Wahrnehmung aus. Man könnte ja auch umgekehrt sagen: ‚Toll, dass man durch die Sonnenkollektoren direkt sehen kann, wie umweltfreundlich die Anwohner*innen sind.‘“

Doch so weit ist es vielerorts noch nicht. Insbesondere zur Windkraft halten sich zahlreiche Vorurteile. Es heißt, die Windräder würden unschöne Schatten werfen, sie würden den Wert der benachbarten Immobilien schmälern, und sie seien mit 50 Dezibel zu laut. 50 Dezibel entsprechen quakenden Fröschen oder dem durchschnittlichen Straßenverkehr. So dreht sich im Landkreis Ebersberg, auf einer Fläche so groß wie der Bodensee, bislang nur ein einziges Windrad. Die geringe Nutzung der Windenergie im Freistaat Bayern liegt nicht nur an möglichen Ängsten der Einwohner*innen, sondern vor allem an der sogenannten 10-H-Regel der Bayerischen Bauordnung von 2014. Sie besagt, dass ein Windrad mindestens das Zehnfache seiner Höhe von Wohnbebauung entfernt sein muss. Also müsste die Siedlung von einem 200 Meter hohen Windrad mindestens zwei Kilometer entfernt liegen – was im dicht besiedelten Ebersberg kaum möglich ist.
Aber die Kraft des Windes gilt auch jenseits der Küsten als zentrale Zukunftstechnologie und Voraussetzung für eine erfolgreiche Energiewende. „Wir haben deshalb vorgeschlagen, den 10-H-Abstand zu unterschreiten und in jeder der 21 Kommunen des Landkreises ein Windrad zu errichten“, fasst Florian Blacha zusammen. „Zumal wir in einer wissenschaftlichen Studie gesehen haben, dass die Akzeptanz von Windrädern nicht wächst, wenn der Abstand zu den Häusern und Wohnungen größer ist. Es ließ sich auch nicht beweisen, dass die oft befürchtete Geräuschbelästigung mit zunehmender Nähe größer wird.“ Zusammen mit einer weiteren Aktiv-BüKE-Teilnehmerin stellte Lea Steiner das Konzept der 21 Windräder für 21 Kommunen im März verschiedenen Kreispolitiker*innen aus Ebersberg vor. „Dort bekamen wir viel Beifall für unsere Idee, vor allem der Aspekt einer gerechten Verteilung der Windräder fand viel Anklang. Erstaunlicherweise sogar von der CSU, die die 10-H-Regel auf den Weg gebracht hat und die entgegen aller Kritik an ihr festhält.“

Nicht nur Luftschlösser gebaut
Doch reichen Applaus und Anerkennung? Lea Steiner und Florian Blacha haben unzählige Zoom-Fortbildungen besucht. Sie haben zusammen mit ihren Mitstreiter*innen einen Blog gestaltet und ihre Vision von einer klimafreundlichen Zukunft geteilt. Überall warben sie für die Akzeptanz für regenerative Energien und versuchten, Ängste, beispielsweise vor Windrädern, durch Einfühlungsvermögen und wissenschaftliche Hintergrundinformationen zu nehmen. Außerdem haben sie ihre Ideen öffentlich vorgestellt und mit Bürgermeister*innen und Kreisrät*innen diskutiert – also das gemacht, was normalerweise Politiker*innen tun. Inzwischen haben sich die ansässigen Bürgermeister*innen beim Thema Windenergie zu einem Vorgehen entschieden, das auf dem Fairnessgedanken von Aktiv-BüKE basiert. Das heißt, viele Gemeinden möchten die Planung für die Windenergieanlagen mit einer gerechten Aufteilung gemeinsam auf den Weg bringen.
Fazit ist: Die Ideen der Aktiv-BüKE-Gruppe werden in naher Zukunft nicht Realität, das war von Anfang an klar. Doch sie konnte Denkanstöße in die Kommunalpolitik einbringen und nicht nur das Interesse von Menschen in ihrem Umfeld wecken, sondern auch das der Medien. Unter anderem die Süddeutsche Zeitung und der Bayerische Rundfunk berichteten mehrmals über sie. Welches Fazit ziehen sie nach einem halben Jahr für ihren Landkreis? „Der große Aha-Moment an dem Projekt war für mich, zu sehen, wie viel einerseits nötig ist, um den täglichen Strombedarf zu decken und um wie geplant bis 2030 frei von fossilen und anderen endlichen Energieträgern zu werden“, so Lea Steiner. „Im Gegensatz dazu das Zögern der Politiker*innen zu erleben war zermürbend. Rechtliche Hindernisse machen alles zusätzlich frustrierend schwer. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, was ich auch meiner Jugend zuschreibe, dass ich jetzt umso mehr möchte, dass sich etwas ändert. Deshalb werde ich wahrscheinlich weiterhin politisch aktiv bleiben.“ Florian Blacha nimmt es ähnlich wahr und fühlt sich ebenfalls motiviert, dranzubleiben. „Unsere Planungen sind keine Utopie. Es geht – auch bei uns hier im Süden von Deutschland. Wenn man will, geht es.“
Aktive Bürgerexpert*innen für Klimawandel und Energiewende
Die von der Stiftung Mercator geförderte Initiative „Aktive Bürgerexpert*innen für Klimawandel und Energiewende“ (Aktiv BüKE) versucht mithilfe eines innovativen Ansatzes, die Bürger*innen vor Ort stärker an der Planung von erneuerbaren Energien zu beteiligen und somit einen aktiven Beitrag bei der Erreichung der deutschen Klimaschutzziele zu leisten.