Wie grün kann Geld sein?

Welche Rolle spielt die Finanzindustrie für den Klimaschutz? Eine erstaunlich große, erklärt John E. Morton. Er war Klima- und Finanzexperte unter Barack Obama und weiß, welche Chancen „Sustainable Finance“, zum Beispiel in Form von nachhaltigen Investitionen, bietet.
John E. Morton war Senior-Direktor für Energie und Klimawandel im Weißen Haus unter Barack Obama und somit auch für die Koordination der politischen Maßnahmen und der Strategien in Sachen nachhaltige Finanzinvestitionen verantwortlich. Im Rahmen des Mercator Fellowship-Programms forschte er 2017/18 an der Handelshochschule Leipzig (HHL) zur Mobilisierung privaten Kapitals für den globalen Klimaschutz.
Herr Morton, wenn es um die Bekämpfung des Klimawandels geht, denkt man an Kohle, denkt man an produzierendes Gewerbe. Nicht automatisch jedoch an den Finanzsektor. Welche Rolle kann er im Erreichen der Klimaschutzziele spielen?
John E. Morton: Der Finanzsektor spielt die wohl zentralste Rolle darin, den Klimawandel zu bekämpfen. Das Finanzsystem steckt hinter allem: was finanziert werden soll, was nicht finanziert werden soll – und wie schnell das alles passiert. Mein Interesse als jemand, der der sich seit 25 Jahren mit dem Thema Klimawandel befasst, ist: Wie kann das Finanzsystem im Kampf gegen den Klimawandel helfen? Nehmen wir als Beispiel den Kohlesektor. Wir müssen den Wandel weg von der Kohleenergie so schnell wie möglich bewältigen. Wie schnell das passiert, ist Sache der Finanzindustrie. Wer wird den nächsten Kohlebergbau finanzieren? Wer wird den Solarpark finanzieren, der den Kohlebergbau ersetzt? Es ist als Bank oder Investmentfirma für die Reputation immer schwieriger geworden, ein Kohlevorhaben zu finanzieren. Die Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten für CO2-intensive Industrien werden kleiner und kleiner. Daher spielt der Finanzsektor eine zentrale Rolle in der Bekämpfung des Klimawandels.

John E. Morton
Der US-Amerikaner John E. Morton lebt in Washington, D.C. und ist Senior Fellow beim Global Energy Center des Atlantic Council.
ETFs (Exchange Traded Funds), die einen bestimmten Index widerspiegeln, spielen in der Finanzindustrie eine sehr große Rolle. Welche Auswirkung haben diese Produkte auf die Bekämpfung des Klimawandels?
Morton: Viele Bereiche unseres Lebens sind wie auf Tempomat gestellt. Unser Finanzsystem verhält sich da ähnlich. ETFs laufen auf Autopilot, investieren automatisch in die erfolgreichsten Unternehmen einer Region oder Branche. Diese aber sind in der Summe sehr klimaschädlich. Wenn wir nichts ändern, führt dies zu einem Temperaturanstieg von vier oder fünf Grad. Das durchschnittliche Investment-Portfolio ist somit nicht im Einklang mit dem Pariser Abkommen (Temperaturanstieg deutlich unter zwei Grad, Anm. d. R.), sondern unterstützt aktuell eine viel, viel wärmere Zukunft. Wenn wir als Gesellschaft unser Geld auf Tempomat in diesen Markt stecken, ist das Teil des Problems.

Was kann man dagegen tun?
Morton: Es gab viel Shareholder- und Stakeholder-Aktivismus, der sich diesem Thema zugewandt hat. Etliche große Banken und Vermögensverwalter*innen haben hart daran gearbeitet, ihren Kund*innen einen emissionsfreundlichen Marktindex zu bieten.
Welche Auswirkungen hat das auf den einzelnen Privatanleger oder die Anlegerin?
Morton: Vor sechs Jahren bin ich zu meiner Bank gegangen und habe gesagt, dass ich alle Industrien mit fossilen Brennstoffen aus meinem Portfolio haben wolle. Die haben mir gesagt, dass sie das nicht machen können, ich müsse mein Geld woanders hinbringen. Und so haben meine Frau und ich das gemacht. Wir sind zu einem kleinen Finanzpartner gegangen, der in nachhaltige Produkte investiert. Das war wie gesagt vor sechs Jahren. Vor sechs Monaten waren wir wieder bei unserer ehemaligen Bank. Sie hatte Dutzende nachhaltige und fossilfreie Produkte anzubieten. Wir sehen also eine schnelle, wenngleich noch zu langsame Antwort der Finanzindustrie, die weiß, dass ihre Kund*innen emissionsarme oder emissionslose Investmentoptionen wollen. Auf institutioneller Ebene beobachten wir, dass sich die großen Indizes, MSCI, der Dow Jones Industrials, der S&P 500 und Co., noch zu sehr auf klimaschädliche Unternehmen fokussieren. Ich glaube aber fest daran, dass diese Indizes in den nächsten zwei oder drei Jahren viel umweltfreundlicher werden. Im Januar hat BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt (sechs Billionen Dollar, Anm. d. R.), angekündigt, klimaneutrale Investments in den Fokus zu stellen. Das heißt, dass das Standardinvestmentprodukt Schritt für Schritt ein nachhaltiges werden wird. Man investiert nicht in den Markt, wie er ist, sondern in den Markt, wie er sein sollte.
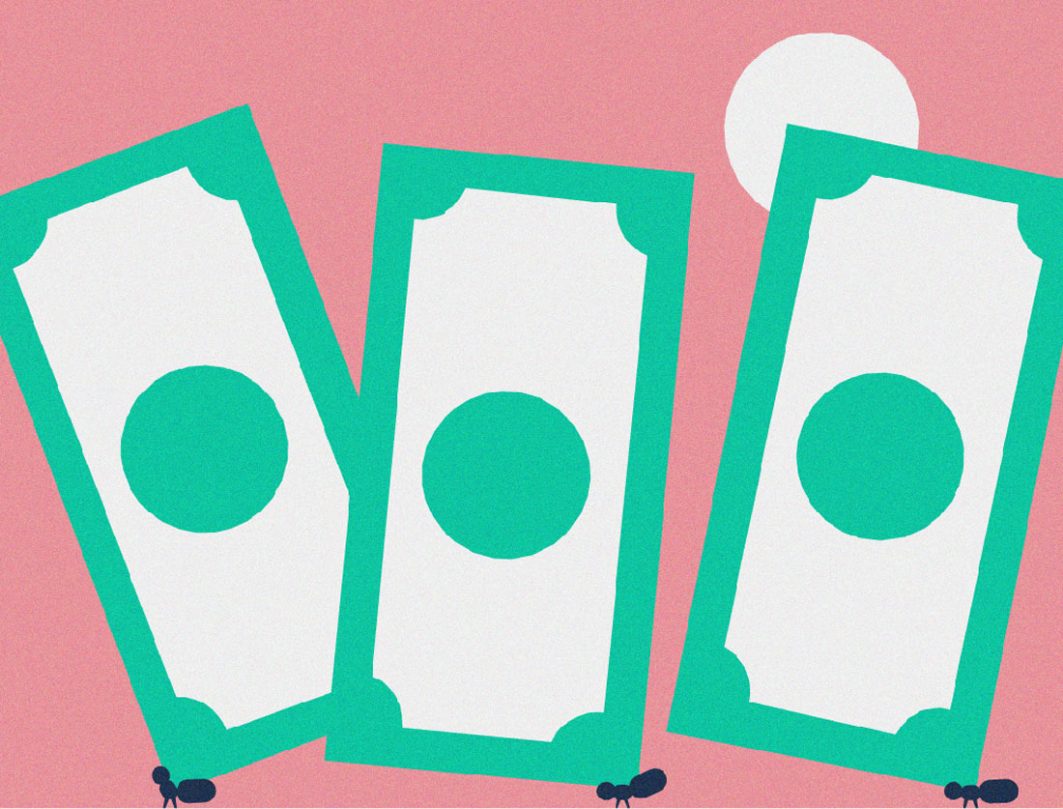
Was ist die systemische Konsequenz daraus?
Morton: Es ist das genaue Gegenstück zu dem, was wir heute haben. Ein Markt, der auf Autopilot läuft, führt dazu, dass Vermögenswerte, die keine Zukunft haben, überbewertet sind. Die Menge an Kapital, die über Indizes in umweltschädliche Unternehmen fließt, bleibt hoch. Dabei ist es keine Frage, ob wir uns von hochgradig CO2-lastigen Unternehmen verabschieden müssen, sondern wann – und wie schnell. Und ich glaube, die Antwort wird sein: sehr schnell. Weil das Standardinvestment für Kund*innen ein klimaneutrales oder zumindest ein im Einklang mit dem Pariser Abkommen stehendes Portfolio sein wird.
Sind damit nicht neue Risiken verbunden?
Morton: Wir müssen das jetzige Risiko in unseren aktuellen Portfolios erkennen. Die Menschen konzentrieren sich auf das Risiko des Übergangs zu einer emissionsarmen Wirtschaft. Das Risiko, diesen Schritt nicht zu tun, ist jedoch viel höher. In unseren aktuellen Portfolios sind emissionsreiche Unternehmen deutlich überbewertet, da sich das finanzielle Risiko von Kohlendioxid noch nicht in den Aktienkursen widerspiegelt. Früher oder später, und ich glaube früher, werden diese Risiken erkannt, und die Aktienkurse werden sich schnell anpassen. Die Frage ist daher: Wie und wann werden wir diesen Schritt gehen? Denn es wird große Anpassungen geben!
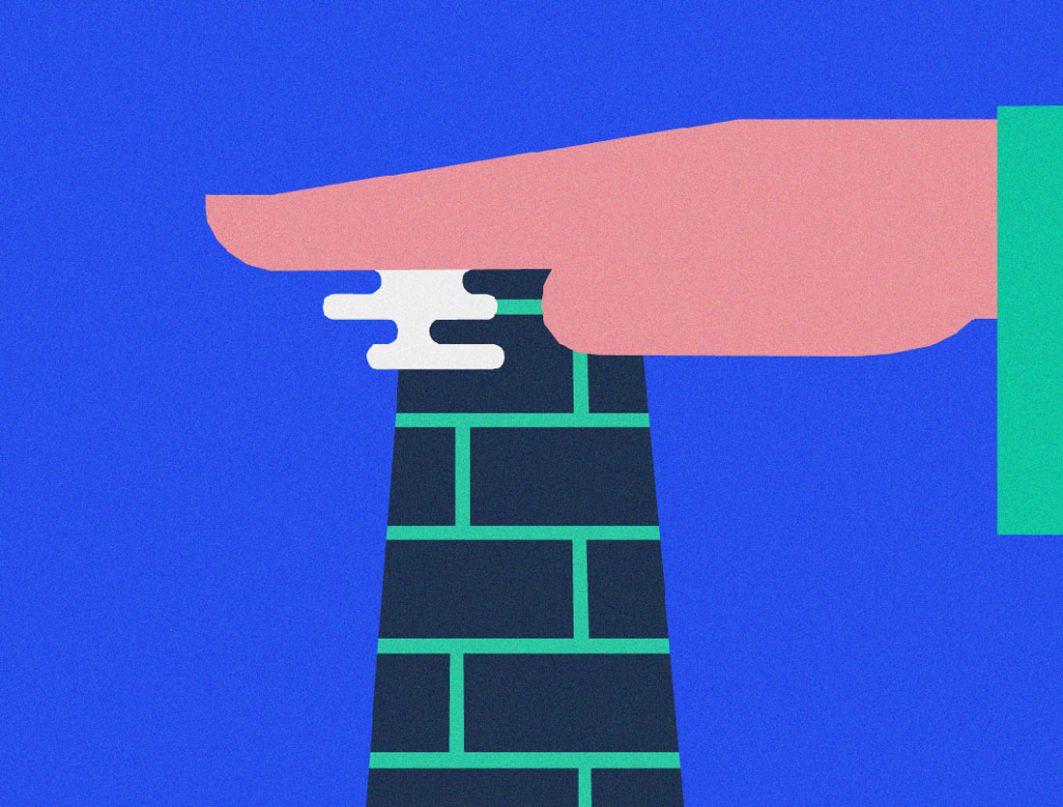
Welches politische Umfeld muss es für eine klimafreundliche Finanzindustrie geben?
Morton: Niemals zuvor hatten wir eine Konvergenz der Signale von Regierungen und subnationalen Verwaltungsebenen einerseits und Marktakteuren und -akteurinnen andererseits. Wir sind inmitten einer Transition zu einer emissionsarmen Wirtschaft. Daraus resultiert: Wer in einer emissionsreichen Wirtschaft agiert, wird unter wachsendem, finanziellem Druck stehen. Wir sehen aktuell in den USA unter der Trump-Administration ein Zurückrudern bei umweltpolitischen Fragen. Trotzdem gab es in den vergangenen drei Jahren eindeutig ein Erstarken von klimaneutralen Unternehmen und ein Abschwächen von kohlendioxid-intensiven Industrien, schneller noch als unter Obama. Der Markt übernimmt hier schnell und, wie ich finde, in die richtige Richtung.
Sind Märkte im Kampf gegen den Klimawandel also wichtiger als Regierungen?
Morton: Die Märkte haben auf Signale reagiert, die von Regierungen rund um den Globus gesendet wurden. Wenn Sie zum Beispiel ein deutscher Automobilbauer sind, wollen Sie dann wirklich Ihren Etat für Forschung und Entwicklung dafür verschwenden, die nächste Generation von Verbrennungsmotoren zu entwerfen? Auf keinen Fall! Es ist klar, dass die politische Richtung ist: CO2 wird bepreist – und wird teurer werden. Die Autobauer*innen müssen also nach vorne schauen, nicht nach hinten. Das machen Märkte auch, sie schauen nach vorne. Aber sie funktionieren am besten mit klaren Signalen und Regulierungen vonseiten der Politik.
Glauben Sie also, dass es zu einer internationalen Besteuerung von CO2-Emissionen kommen wird?
Morton: Ich glaube, wenn, dann wird es lange dauern, bis es einen internationalen Preis für CO2-Ausstoß geben wird. Ich weiß noch nicht einmal, ob es jemals einen weltweiten Preis für CO2 geben wird. Ich glaube aber auch nicht, dass das nötig ist. Was wir jetzt schon sehen: Länder und Regionen führen erfolgreich einen CO2-Handel ein. Solche regionalen Maßnahmen sind sehr wirksam. Sie beeinflussen das Konsumentenverhalten und die Investmententscheidungen in Märkten. In Teilen der USA zum Beispiel haben wir einen sehr aktiven Emissionshandel seit nunmehr fast 20 Jahren. Wir sehen also, dass schon heute Regionen den CO2-Ausstoß bepreisen. Diese Anstrengungen sind wirklich erfolgreich, weil sie das Investmentverhalten verändert haben.
Als Mercator-Fellow 2017/18 gingen Sie an der Handelshochschule Leipzig der Frage nach, wie Weltwirtschaft und Klimaschutz vereinbart werden können. Sie kennen also die Bundesrepublik. Welche Rolle spielt Deutschland im Kampf gegen den Klimawandel?
Morton: Zuallererst: Die Welt muss der Bundesrepublik dankbar sein für die Rolle, die sie darin gespielt hat, schnell und dramatisch die Kosten für Solarenergie zu senken. Es waren deutsche Gesetze, die die innerstaatliche Nachfrage nach Solartechnologie angekurbelt haben und somit dafür gesorgt haben, dass die Preise für Solarpanels weltweit gesunken sind. Zweitens: Es ist sehr schwer, eine kohleintensive Wirtschaft klimaneutral umzugestalten, wenn man gleichzeitig die Nuklearwerke vom Netz nimmt. Das ist keine Kritik, nur eine Feststellung. Ich hoffe aber, dass Deutschland die Ziele der Kohlekommission viel schneller umsetzen wird als vorgesehen. Der Rest Europas braucht Deutschland, um eine weitaus wichtigere Rolle im Kampf gegen den Klimawandel zu spielen.
Mercator Fellowship-Programm
Das Mercator Fellowship-Programm bietet seinen Stipendiat*innen den Freiraum, sich explorativ und ideenreich einem Forschungs- oder Praxisvorhaben zu widmen.