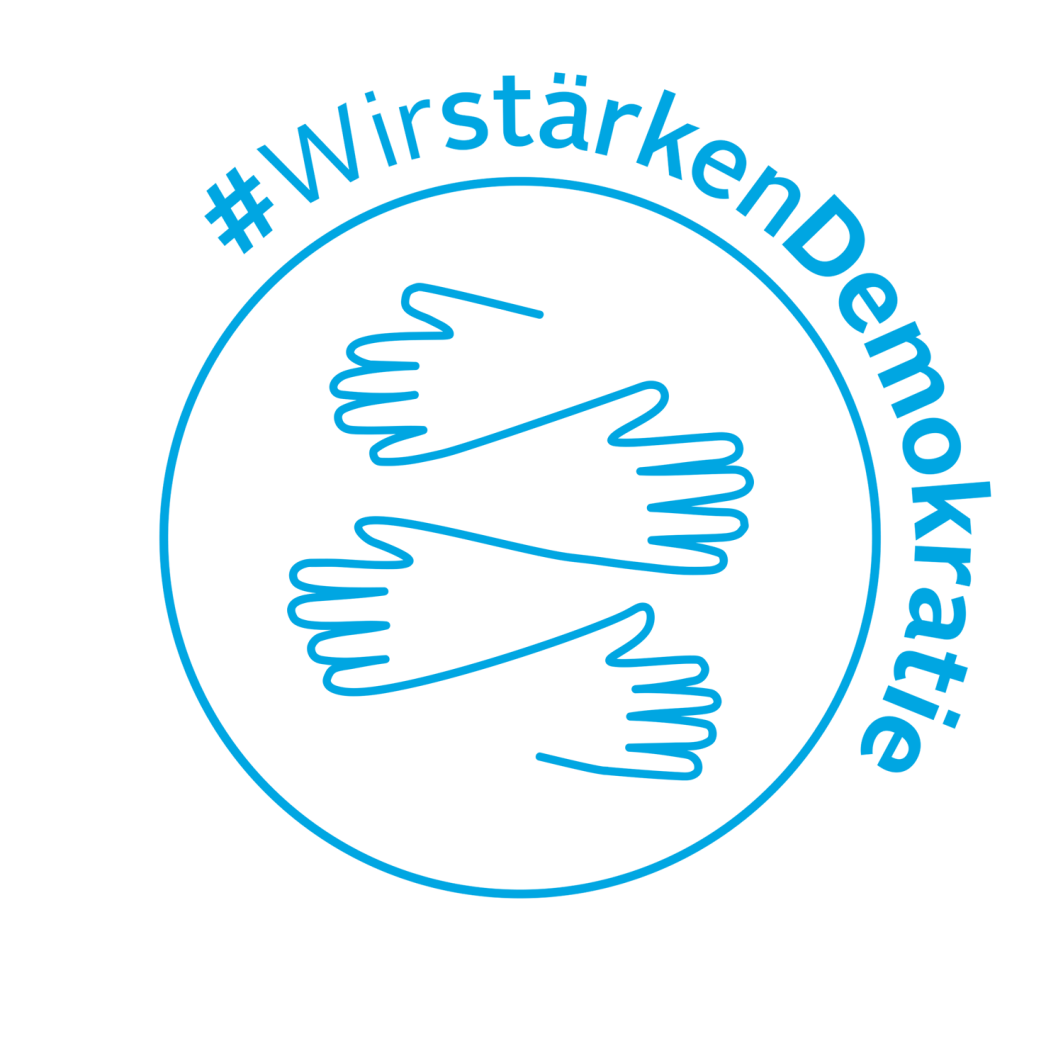Individuelle Appelle für mehr Klimaschutz bringen nichts

Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein. Doch dieses Ziel ist in Gefahr und mit einer CO2-Bepreisung und technologischen Entwicklungen allein nicht zu erreichen, warnen Expert*innen. Wie es trotzdem funktionieren könnte, erforscht der Soziologe Stefan C. Aykut im Rahmen einer neuen Mercator-Stiftungsprofessur an der Universität Hamburg.
Herr Aykut, wie realistisch ist es aus Ihrer Sicht, dass Deutschland sein Klimaschutzziel, bis 2045 klimaneutral zu sein, noch erreichen kann?
Stefan C. Aykut: Das ist schwer zu sagen. In der Vergangenheit wurde diese Frage vor allem von Natur- oder Wirtschaftswissenschaftler*innen beantwortet. Sie haben sich beispielsweise angesehen, welches Kohlenstoffbudget uns noch bleibt für ein bestimmtes Temperaturziel oder wie sich Märkte durch politische Eingriffe wie eine CO2-Steuer beeinflussen lassen. Doch unsere Alltagserfahrungen zeigen, dass das technische und ökonomische Wissen letztlich nichts darüber aussagt, ob auch die gesellschaftlichen Voraussetzungen für das Erreichen der Klimaneutralitätsziele gegeben sind. Deshalb haben wir im Exzellenzcluster „Climate, Climatic Change, and Society“ (CLICCS) an der Universität Hamburg auf globaler Ebene untersucht, wie soziale Treiber den gesellschaftlichen Wandel beeinflussen. Als soziale Treiber gelten etwa Klimaproteste, Klimaklagen oder das Konsumverhalten. Nun werde ich im Rahmen der von der Stiftung Mercator geförderten Professur das, was ich auf globaler Ebene untersucht habe, auf Deutschland übertragen und hier den Fokus auf vielfältiges zivilgesellschaftliches Engagement rund um die Klimafrage legen.
Welche Rolle spielt die Gesellschaft beim Erreichen der Klimaschutzziele?
Die Gesellschaft kann den Klimaschutz beschleunigen oder eben ausbremsen. So wäre zum Beispiel vieles, was seit 2019 klimapolitisch in Deutschland begonnen wurde, ohne die gesellschaftliche Mobilisierung durch die „Fridays-for-Future“-Bewegung nicht möglich gewesen. Andererseits schreiten Bemühungen um den Klimaschutz nicht so schnell voran, wie sie es müssten, weil Unternehmen den Klimaschutz blockieren oder Anwohner*innen gegen Windparks demonstrieren. Wie gesellschaftliche Dynamiken aber zum Erreichen oder Nichterreichen der Klimaziele beitragen und wie sich das untersuchen lässt, ist noch nicht genau klar.

Professor Dr. Stefan C. Aykut studierte in Berlin, Istanbul und in Paris, wo er 2012 promovierte. Seit 2017 ist er Juniorprofessor für Soziologie an der Universität Hamburg. In seiner Forschung verbindet Aykut Konzepte und Methoden aus Soziologie, Politikwissenschaft und Wissenschaftsgeschichte, um die soziale und politische Dynamik ökologischer Krisen und Konflikte zu erfassen. 2019 zeichnete ihn die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) mit dem Heinz Maier-Leibnitz-Preis für Nachwuchswissenschaftler*innen aus. Im Mai 2023 trat er die Mercator-Stiftungsprofessur an der Universität Hamburg an, mit der er einen neuen Ansatz in der sozialwissenschaftlichen Forschung etablieren möchte. Mit einer Studie überprüft Aykut künftig jährlich, ob Deutschland seine Klimaschutzziele erreichen kann.
Welche sozialen Treiber würden Sie besonders hervorheben?
Die Treiber Konsumverhalten und Unternehmensaktivitäten sind sicher sehr zentral für die Emissionsentwicklung und wirken leider bremsend. Denn wir sehen weder, dass die Menschen ihr Einkaufsverhalten spontan ändern, noch dass sich eine große Anzahl von Unternehmen freiwillig dem Klimaschutz verpflichtet. Eher im Gegenteil. Ein weiterer wichtiger Treiber ist die Klimapolitik, da sie strukturelle Weichen stellen kann. Und dann gibt es noch die zentralen Treiber Klimaproteste und zivilgesellschaftliches Engagement, die Politiker*innen und Unternehmensführungen direkt adressieren. Es geht hier aber nicht um die Frage der Hierarchie der einzelnen Treiber. Wir müssen uns diese eher als stark miteinander verbunden vorstellen.
Wir müssten die Klimapolitik an Diskussionen um Lebensqualität und Stadtplanung knüpfen, statt den Leuten zu sagen, dass sie weniger Auto fahren sollen. Denn das bringt nichts.
Bislang ist ein verschwindend geringer Anteil der Gelder, die zwischen 1990 und 2018 global für Klimaforschung bereitstanden, in sozialwissenschaftliche Untersuchungen geflossen – nur knapp 5 Prozent der Klimaforschung und 0,12 Prozent der gesamten Forschungsmittel.
Das ist ein wichtiger Punkt. Lange Zeit gingen viele davon aus, das Klimaproblem sei ein Wissensproblem: Gäbe es nur genug Wissen und Evidenz über die Entstehung des menschengemachten Klimawandels, dann würde die Politik entsprechend handeln – davon waren viele überzeugt. Nun haben wir die globale Institution IPCC, den Weltklimarat, der regelmäßig wissenschaftlich fundierte Sachstandsberichte zum derzeitigen Kenntnisstand über den Klimawandel veröffentlicht. Wir haben sehr viel Wissen und sehr viele Handlungsempfehlungen. Und trotzdem werden keine ausreichenden Klimaschutzmaßnahmen auf politischer oder individueller Ebene getroffen. Die Menschen verändern nicht einfach ihr Verhalten, nur weil sie wissen, dass es den Klimawandel mit seinen düsteren Prognosen gibt. Sie wählen nicht mehrheitlich die Politiker*innen, die sich verstärkt für den Klimaschutz einsetzen. Das heißt, wissenschaftliche Erkenntnisse ziehen per se kein klimafreundliches Verhalten nach sich. Damit haben wir eine Krise des Paradigmas, dass Wissen Handeln schafft. Die zweite Sache ist, dass wir erst in jüngerer Zeit die Bedeutung der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Klimawandel bewusst wahrnehmen und erkennen, dass wir ihre Rolle noch nicht hinreichend verstehen.
Der Paradigmenwechsel und die Bedeutung der Soziologie erinnern an die Coronapandemie. In dieser Zeit dachten wir auch, wenn wir genug über Viren wüssten, ließe sich die Pandemie rasch in den Griff bekommen.
Genau. Damals ging es zunächst darum, das Virus besser zu verstehen. Im zweiten Schritt haben wir gemerkt, dass wir auch das menschliche Verhalten in die Überlegung der zu treffenden Maßnahmen mit einbeziehen müssen, und in Talkshows saßen plötzlich vermehrt Soziolog*innen. Ein wichtiger Unterschied zwischen der Pandemie und dem Klimawandel ist natürlich, dass wir bei der Pandemie wussten, dass die eingeforderten Verhaltensänderungen vorübergehend sein werden, daher wurden sie von der Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert. Für den Klimawandel brauchen wir tiefgreifende Veränderungen, die dauerhaft verankert werden müssen. Entsprechend ist es im Unterschied zur Pandemie noch wichtiger, dass wir verstehen, wie Gesellschaft und der gesellschaftliche Wandel funktionieren.
Es gibt einen menschengemachten Klimawandel, den es durch Dekarbonisierung aufzuhalten gilt, zum Beispiel durch weniger Mobilität auf den Straßen und in der Luft. Das klingt doch eigentlich einfach.
Ja – und nein. Wir wissen, dass wir eine Veränderung im Konsumverhalten der Menschen brauchen, um die Klimawende zu meistern. Zum Beispiel verbraucht die Produktion von Fleisch als Lebensmittel sehr viel CO2. Entsprechend wäre es klimapolitisch richtig, die Ernährungsgewohnheiten auf pflanzenbasierte Nahrungsmittel umzustellen. Aber auch wenn die Deutschen in den vergangenen Jahren weniger Fleisch gegessen haben als zuvor, gibt es immer noch zu wenig Menschen, die auf Fleisch verzichten. Und auch die Politik stellt keine entsprechenden Weichen. Was müsste also passieren, damit sich das Konsumverhalten im Hinblick auf Fleisch ändert? Wenn wir uns auf globaler Ebene verschiedene, mit Ernährung assoziierte Dynamiken ansehen, stellen wir fest, dass es in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen einen Trend zu biologischer Ernährung, zu Vegetarismus oder Teilvegetarismus gibt. Dieser hat erst mal nicht unbedingt etwas mit Klimaschutz zu tun. Diese gesellschaftlichen Dynamiken könnten dennoch aufgegriffen und mit Maßnahmen zum Klimaschutz verbunden werden.

Wie könnte das aussehen?
Wir müssten das Ziel des Klimaschutzes mit dem Wunsch nach gesunder Ernährung, nach Tierwohl oder einem Wandel in der Landwirtschaft verknüpfen. Solange in Massentierhaltung produziertes Fleisch aber so günstig ist, bleibt das ein wohl unerreichbares Unterfangen. Ein anderes Beispiel ist die Mobilität. Die individuelle Mobilität zu verändern, ist insbesondere dann schwierig, wenn viele Menschen auf dem Land oder in einer schlecht angebundenen Region auf das Auto angewiesen sind. Zumal die Politik lange Zeit die Zersiedelung der Landschaft dadurch gefördert hat, indem sie Pauschalen für Pendler*innen gewährt und Eigenheime jenseits der Stadtzentren subventioniert hat. Aber angesichts des Klimawandels müssten wir, das ist hinreichend erforscht, die Städte zunehmend verdichten, weil dann die Wege etwa zum Arbeitsplatz oder zur Schule kürzer wären und besser mit dem öffentlichen Nahverkehr oder mit dem Fahrrad bewältigt werden könnten. Das wird mit Blick auf die USA deutlich, wo die Emissionen pro Kopf auch deshalb viel höher als in Europa sind, weil die Zersiedelung viel weiter als hierzulande vorangeschritten ist. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse und unter Gesichtspunkten des Klimawandels erhalten Diskussionen über lebenswerte Innenstädte eine ganz andere Aktualität und Relevanz, als viele gemeinhin angenommen haben. Wir müssten die Klimapolitik an Diskussionen um Lebensqualität und Stadtplanung knüpfen, anstatt den Leuten einfach zu sagen, dass sie weniger Auto fahren sollen. Denn das bringt nichts.
Könnten so Handlungsempfehlungen für Politiker*innen aussehen? In der Studie im Rahmen der Mercator-Stiftungsprofessur betreiben Sie nicht nur Grundlagenforschung, sondern generieren auch praktische Tipps.
Ja, wobei sich die Handlungsempfehlungen nicht nur an die Politik, sondern auch an die Zivilgesellschaft richten. Wir werden deshalb eine Website aufbauen, eine Datenbank, anhand derer sich die Dynamik von bestimmten Treibern nachverfolgen lässt. Zusätzlich möchten wir unsere Erkenntnisse durch Workshops mit gesellschaftlichen Akteur*innen und durch regelmäßige Veröffentlichungen den Protagonist*innen der Klimabewegung zugänglich machen.

Der Klimawandel schreitet schneller voran, als man vor einigen Jahren vielleicht noch dachte. Ist Ihre Arbeit ein Wettlauf gegen die Zeit?
Es ist dringlich. Gleichzeitig ist mein persönlicher Zugang, dass es nichts nützt, sich immer wieder vom Aspekt der Dringlichkeit frustrieren zu lassen. Denn die Transformation zur Klimaneutralität ist nur möglich, wenn die Maßnahmen sinnvoll und zielführend sind – sonst kommt es zu Backlashes. Wir haben genau das in Frankreich gesehen, wo sich an einer Ökosteuer Demonstrationen entzündet haben, weil deren Umsetzung als zutiefst ungerecht wahrgenommen wurde. Schlecht gemachte Maßnahmen, die im Sinne des Klimas vielleicht mal gut gemeint waren, können sich schnell ins Gegenteil verkehren und dann gesellschaftliche Dynamiken auslösen, die einen schnelleren Klimaschutz verhindern.
Wie würden Sie in diesem Zusammenhang die Aktionen der „Letzten Generation“ bewerten?
Die Situation ist zu frisch, uns liegen noch keine belastbaren Daten zur „Letzten Generation“ vor. In geschichtlicher Hinsicht ist es aber so, dass soziale Bewegungen oftmals sogenannte radikale Flanken entwickeln. Das war so bei der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung der Black Panthers, bei der britischen Frauenwahlrechtsbewegung und auch bei der deutschen Anti-Atomkraft-Bewegung. Eine Hypothese, die in diesem Zusammenhang häufig hervorgebracht wird, ist die, dass radikale Flanken dazu dienen können, den moderaten Teil einer solchen Bewegung als gesellschaftsfähig erscheinen zu lassen. Die Leute könnten also sagen: „Die Chaot*innen von der ‚Letzten Generation‘ finden wir nicht gut, aber die ‚Fridays for Futures‘ sind sehr vernünftig.“ Klar ist, dass die „Letzte Generation“ den Blick auf ein wichtiges Thema lenkt – und diese Aufmerksamkeit ist wichtig. Ob ihre Taktiken langfristig Erfolg haben werden, darüber kann ich mir bislang kein Urteil erlauben.
Sie haben sich Ihr Studium in Paris als Barpianist querfinanziert. Ist für Sie Musik ein guter Ausgleich zum mitunter belastenden Thema Klimaschutz?
Die Musik, auch als Sänger und Instrumentalist in einer Band, ist für mich inzwischen Teil meiner Identität geworden. Sie bietet mir bei den manchmal in der Tat deprimierenden beruflichen Fragen einen anderen Zugang zu Emotionen und zur Gesellschaft. Und verschafft mir nicht zuletzt Momente, in denen ich die politischen und ökologischen Fragen für einen Augenblick beiseitelassen kann.
Gesellschaftliche Dynamiken der Klimawende
Die gesellschaftlichen Dynamiken, die die Dekarbonisierung hemmen und antreiben, werden politisch nicht hinreichend adressiert, aber auch wissenschaftlich nicht systematisch erfasst. Die Stiftung Mercator hat deshalb eine Stiftungsprofessur zu Klima und Gesellschaft an Stefan C. Aykut vergeben. Der Soziologe etabliert damit ein neues Forschungsfeld an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, das die Universität Hamburg auch nach Ablauf der fünfjährigen Förderungsperiode durch die Stiftung Mercator weiterführen wird.
hamburg.de/newsroom/presse/2023/pm19.html