Eine Plattform gegen den Hass im Netz

Hatespeech geht Betroffenen nicht nur irgendwann auf die Nerven und reibt an der emotionalen Substanz, sondern überschreitet häufig auch rechtliche Grenzen. Mit Hassmelden.de erleichtern Netzaktivist*innen wie Leonhardt Träumer die Zivilcourage im Netz.
Sie werden beleidigt und bedroht: Zahlreiche Politiker*innen und Prominente, besonders Frauen und Personen mit Migrationshintergrund, sind Opfer von Hassattacken im Netz. Die Grünen-Politikerin Renate Künast sorgte dieses Jahr für Schlagzeilen, als sie Facebook verklagte – in der Hoffnung, eine Grundsatzentscheidung zu erzwingen. Zuvor hatte sie bereits einige Runden vor Gerichten gedreht, in vielen Punkten bekam sie schlussendlich Recht.
Hatespeech ist ein großes Problem. Das ist mittlerweile auch den meisten Nutzer*innen von Twitter, Instagram und Co. bewusst. Nachdem die Aufklärung nun auch ein breites Publikum erreicht hat – wie geht es weiter? Diese Frage haben sich zahlreiche Netzaktivist*innen gestellt. Entstanden sind in den letzten Jahren Initiativen wie zum Beispiel JUUUPORT e. V. oder das Forum für Streitkultur, die sich zum Ziel gesetzt haben, für eine konstruktive Diskussionskultur in Kommentarspalten und in Foren zu sorgen. Auch die Aktivist*innen von Reconquista Internet stellten sich diese Frage. Leonhardt Träumer war bei der Initiative von Moderator Jan Böhmermann aktiv und erinnert sich: „Irgendwann hatten wir das Gefühl, dass das Problem jetzt bei allen angekommen ist, die es interessiert. Dann ging es in der Konsequenz darum, Lösungsvorschläge anzubieten, anstatt laut zu schreien.“ Gemeinsam mit Kolleg*innen machte sich Träumer an den Kern des Problems: Wo gibt es Wege, um Hassrede im Netz konkret zu bekämpfen? Wie kann man diese anderen Nutzer*innen öffnen, damit möglichst viele Menschen teilhaben können?
Neben Gegenrede ist auch das Melden von Hatespeech ein Lösungsansatz. Doch wie gut funktioniert eigentlich die Melden-Funktion über die Netzwerke? Träumer und seine Mitstreiter*innen testeten es. Sie reichten eine Zeit lang alle Beiträge ein, die sie als strafrechtlich relevant einstuften. Sie dokumentierten, ob überhaupt und wie schnell die Plattformen auf die Melden-Anfrage reagierten. Ihr Fazit war ernüchternd: „Man kann die Melden-Funktion über die Netzwerke nicht guten Gewissens empfehlen“, fasst Träumer zusammen.
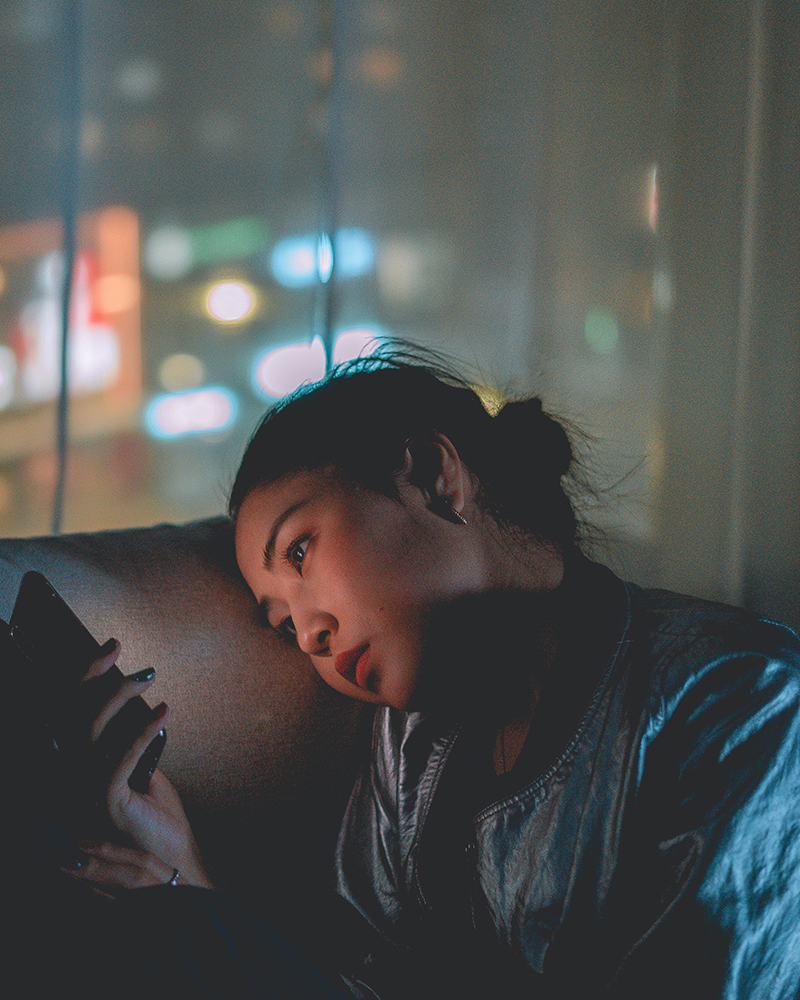
Betroffene trauen sich häufig nicht, Anzeige zu erstatten
Welche anderen Möglichkeiten haben Betroffene von Hatespeech dann? Bei strafrechtlich relevanten Inhalten wäre es möglich, bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Doch die wenigsten nutzen diese Option. Sicherheit und Anonymität spielen dabei eine große Rolle, so Träumer. Viele Betroffene fürchten, dass sich die Angriffe gegen sie von der virtuellen in die reale Welt verlagern könnten. Mit Hassmelden.de möchten die Aktivist*innen deshalb eine Plattform schaffen, auf der Betroffene, aber auch andere Nutzer*innen Hatespeech melden können – anonym und ohne großen Aufwand. „Wer bei uns einen Beitrag meldet, wird auf keinen Fall selbst oder mit seiner Adresse in einer Ermittlungsakte auftauchen“, verspricht Träumer. Damit hat die Gruppe einen Nerv getroffen: Seit der Gründung 2019 sind 300.000 Meldungen eingegangen, allein dieses Jahr knapp 200.000. Das macht 1.000 Meldungen jeden Tag. „Das ist schon sehr viel Zivilcourage“, betont Träumer.
Beiträge einreichen kann man bei Hassmelden.de über vier Wege: über die Website, über den Messenger-Dienst Telegram, per App oder auch per E-Mail. Um das Beweismaterial zu sichten, speichert das System automatisch die Links und macht Screenshots der Seiten. Jede Meldung wird dann noch einmal durch das ehrenamtliche Team von Hassmelden.de händisch gecheckt, um sicherzugehen, dass auch Videos, Sprachnachrichten oder Beiträge aus geschlossenen Gruppen erfasst werden können – denn hiervon kann das System nicht automatisch eine Aufzeichnung erstellen. Das „Prüf-Team“ ist außerdem geschult und kann erkennen, was strafrechtlich relevant sein könnte und was nicht. Denn wer sich noch nicht mit dem Strafgesetzbuch beschäftigt hat, kann das nicht so einfach durchschauen. „Die häufigsten strafrechtlich relevanten Fälle, die bei uns ankommen, sind volksverhetzende Inhalte“, erzählt Träumer. Etwa 60 Prozent der gemeldeten Beiträge, die sie zur Anzeige bringen, entfallen auf diesen Punkt. Täter*innen drohen Geld- oder sogar Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren.
Wer bei uns einen Beitrag meldet, wird auf keinen Fall selbst oder mit seiner Adresse in einer Ermittlungsakte auftauchen
Der Hass bleibt nicht im Netz
Doch was ist so gefährlich an Hatespeech? Erst im vergangenen Jahr brachte die Bundesregierung ein umfangreiches Maßnahmenpaket gegen Hasskriminalität auf den Weg. Bei Morddrohungen und Hassrede in sozialen Medien soll ein Gesetz, das neue Regeln und Strafverschärfungen vorsieht, die Hasskriminalität bekämpfen. Neben der Befürchtung, dass bestimmte Meinungen aus Sorge vor beleidigenden Reaktionen oder Drohungen nicht mehr geäußert werden und sich Menschen ganz aus dem Diskurs zurückziehen, hat das Maßnahmenpaket der Regierung indirekt auch eine tragische Vorgeschichte. Am 1. Juni 2019 wurde der CDU-Politiker Walter Lübcke vor seinem Haus von dem Rechtsterroristen Stephan Ernst erschossen. Diese Tat hatte sich im Rückblick durch jahrelange Hassattacken und Drohungen, nachdem Lübcke sich auf einer Bürgerversammlung für Geflüchtete starkgemacht hatte, angekündigt. Der Mord an Walter Lübcke ist dabei nur ein Beispiel von vielen, in denen der Weg von der Beleidigung in der Kommentarspalte bis zum körperlichen Angriff immer kürzer wird. Es geht mit der Meldung von Hatespeech also nicht nur um eine Diskussionskultur, sondern auch um die Prävention von realer Gewalt.
Relevante Paragrafen aus dem Strafgesetzbuch
§ 130 StGB: Volksverhetzung
§ 111 StGB: Öffentliches Billigen und Gutheißen von Straftaten
§ 140 StGB: Belohnung und Billigung von Straftaten
§ 86a StGB: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen
§ 187 StGB: Verleumdung
„Alle Nutzer*innen tragen eine Mitverantwortung“
Etwa jeder dritte Beitrag, der bei Hassmelden.de eingereicht wird, wird von der Organisation auch zur Anzeige gebracht. Träumer berichtet, dass diese Zahl in den letzten zwei Jahren stetig gestiegen ist. „Wir geben immer Feedback, warum wir etwas nicht anzeigen können. Die Nutzer*innen haben also gelernt, mit was wir arbeiten können und mit was nicht.“ Ziel der Initiative ist es, weiterhin über die Möglichkeit aufzuklären, juristisch gegen Hatespeech vorzugehen. Nicht nur als betroffene Person – alle Nutzer*innen tragen eine Mitverantwortung, wenn es darum geht, „Hater*innen“ die Grenzen aufzuzeigen. „Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig“, ist Träumers Motto, wenn es um das Melden grenzwertiger Beiträge geht. Stumme Passant*innen sind nämlich ein Teil des Problems: Menschen, die online Zivilcourage zeigen, sind rar gesät. Im Netz fühle man sich eher als Teil des Publikums, anstatt aktiv an der Gestaltung teilzunehmen, so Träumer. Hassmelden.de möchte es den Passant*innen so einfach wie möglich machen, „ein kleines, aber wichtiges Zeichen zu setzen“. „Den Link in ein Textfeld zu kopieren und einen Knopf zu klicken kann man nun wirklich jeder und jedem zumuten“, findet Träumer.
Nach dem Klick auf „Beitrag melden“ hat man das Soll bereits erfüllt. Hassmelden.de versucht, den weiteren Verlauf trotzdem so transparent wie möglich zu halten, damit die User*innen auch sehen können, was mit ihrer Aktion passiert. Sie erhalten regelmäßig Benachrichtigungen über den aktuellen Stand oder bekommen eine Erklärung, weshalb der Beitrag nicht zur Anzeige gebracht werden konnte. Bis zum Schluss des Verfahrens kann Hassmelden.de die meisten Beiträge aber nicht verfolgen. Mit der Anzeigenerstattung geben die sechs Jurist*innen den Fall ab. Der nachfolgende Prozess kann sich über Wochen, sogar über Monate hinziehen. Dabei steht die Initiative in Kontakt mit den zuständigen Ermittlungsbehörden, bei denen dann die Aufgabe liegt, Tat und Täter*innen aufzudecken und das Strafverfahren durchzuführen – eben wie bei jedem anderen Strafdelikt auch.
Das Problem hinter Hatespeech kann Hassmelden.de kurzfristig nicht an der Wurzel packen. Trotzdem blickt Träumer optimistisch in die Zukunft: „Was ich zum Beispiel als sehr positiven Trend sehe, ist, dass wir in unserer Expertenrolle häufig eingeladen werden zu Veranstaltungen mit Schüler*innen.“ Hassrede wird also von einem immer breiteren Publikum als Problem wahrgenommen, und der Wille, etwas zu ändern, wächst. Das Ziel: sich überflüssig machen – dass es Hassmelden.de irgendwann nicht mehr geben muss, weil man andere Wege gefunden hat, Hatespeech zu bekämpfen, oder weil es Hatespeech im besten Fall gar nicht mehr gibt.
Das NETTZ
Das NETTZ ist eine Vernetzungsstelle gegen Hatespeech, die digitale Zivilcourage fördert und für eine positive Debatten- und Meinungskultur im Netz eintritt. Akteur*innen der Zivilgesellschaft werden als „Community der Gegenrede“ gefördert und unterstützt.
www.das-nettz.de
