Inspirierende Wege der Veränderung: 5 Erfahrungen aus 15 Jahren Mercator Kolleg
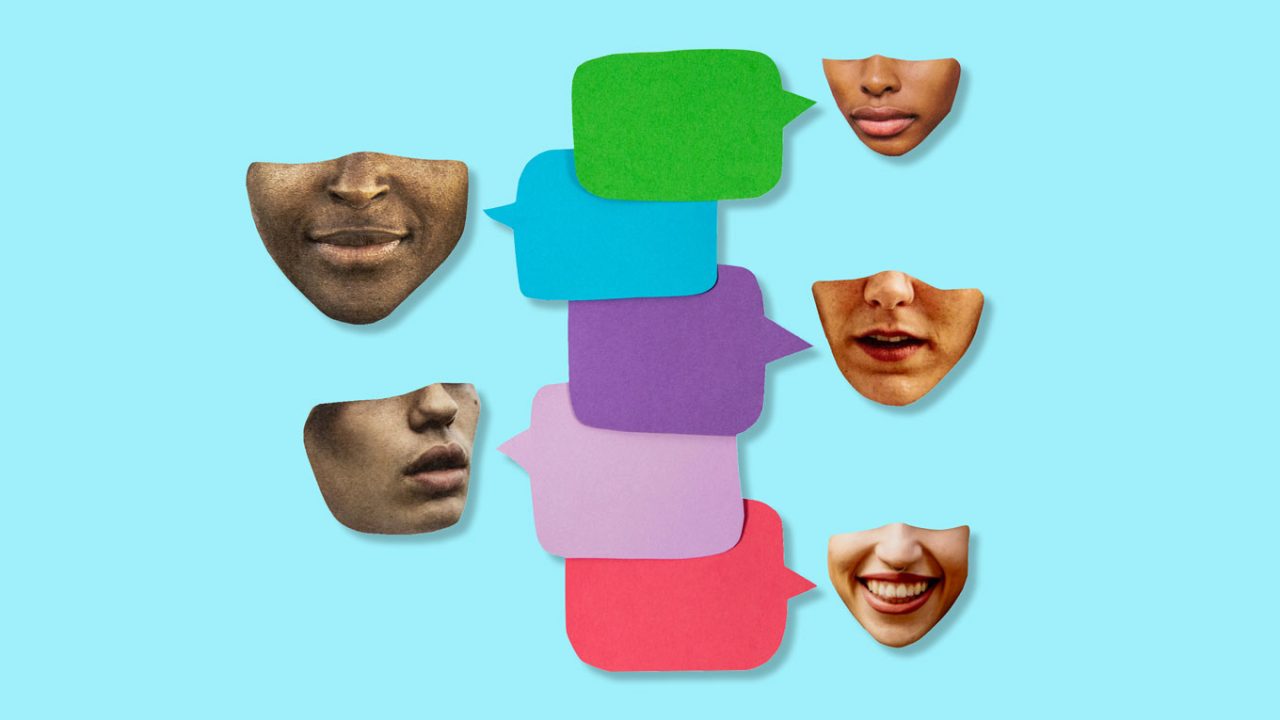
Das Mercator Kolleg für internationale Aufgaben fördert junge Menschen, die Verantwortung für die Welt von morgen übernehmen. Wir stellen 5 Geförderte der letzten 15 Jahre vor.
Ob Diversität in der internationalen Politik, Blended Finance oder Lehren aus der deutschen Afghanistan-Mission: So vielfältig sind die Themen, an denen Stipendiat*innen des Mercator Kollegs für internationale Aufgaben arbeiten. Das Programm begeistert seit 15 Jahren junge Menschen aus Deutschland und der Schweiz für die internationale Zusammenarbeit.
Wie funktioniert’s? 25 Hochschulabsolvent*innen und Berufsanfänger*innen werden jährlich in das zwölfmonatige Programm aufgenommen, das neben der finanziellen Förderung auch fachlichen Austausch und die Vermittlung von Führungskompetenzen umfasst. In den vergangenen 15 Jahren ist auf diese Weise eine Gemeinschaft von über 400 Alumni*ae entstanden, die im Netzwerk für internationale Aufgaben (nefia e. V.) organisiert ist. Wir stellen 5 Menschen aus den vergangenen 15 Jahren vor.
Mirco Günther: Krisenmanager und Experte für Asien und Osteuropa
(geboren 1984, Kollegjahrgang 2009-2010)
2003 stand Mirco Günther in einer Suppenküche in Cherson, Ukraine, und versorgte ehemalige KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter*innen. „Die Zeit meines Zivildienstes hat mich wahnsinnig geprägt“, erinnert sich Mirco Günther heute. „In meiner persönlichen Entwicklung, aber auch meine Leidenschaft für internationale Arbeit und Verständigung.“
Ob Praktika in Wladiwostok und Tbilissi oder Einsätze der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Tadschikistan und Kasachstan: Das Interesse für den postsowjetischen Raum zieht sich wie ein roter Faden durch Günthers frühen beruflichen Jahre. Geboren 1984 in Bischofswerda in Sachsen, studierte er nach dem Zivildienst Politikwissenschaften in Berlin und Moskau sowie Middle East and Central Asian Security Studies im schottischen St. Andrews. 2009 bewarb er sich für den ersten Jahrgang des Mercator Kollegs: „Für mich war das Kolleg das Sprungbrett in die Berufslaufbahn der internationalen Organisationen.“
Mit nur 25 Jahren wurde Mirco Günther zum Referatsleiter der OSZE in Duschanbe, Tadschikistan, ernannt – noch bevor das Jahr seiner Mercator-Förderung beendet war. 2014 – er studierte damals an der Harvard Kennedy School – ging er mit nur 48 Stunden Vorwarnung als „First Responder“ in die Ostukraine, um die dortige OSZE-Beobachtermission aufzubauen. „Der schwierigste Einsatz meines Lebens“, erzählt Günther. Doch ob Kabul oder Charkiw – an diesen Krisenposten sei er immer gewachsen: „Durch die unmittelbare Relevanz der Arbeit und die Dankbarkeit der Menschen.“

2016 wechselte Mirco Günther von der OSZE zur Friedrich-Ebert-Stiftung, erst als Direktor des Landesbüros in Afghanistan und des FES-Regionalbüros in Singapur, später als Leiter des Referats Asien und Pazifik in Berlin. „Als politischer Mensch schätze ich die dezidiert politische Arbeit bei der FES.“
Dem Mercator Kolleg bleibt er auch nach 15 Jahren eng verbunden. „Ich genieße das Alumni-Netzwerk und den Freundeskreis“, sagt Mirco Günther. Darüber hinaus engagierte er sich immer wieder in den Auswahlkommissionen. „Ich finde es toll, dass die Jahrgänge sowohl in den persönlichen als auch in den fachlichen Hintergründen stetig diverser werden“, meint er. „Der Austausch mit den nachfolgenden Generationen ist immer wieder auch ein Korrektiv für die eigene Weltanschauung.“

Rim Melake: Sozialunternehmerin und Innovationsexpertin
(geboren 1991, Kollegjahrgang 2020–2021)
Bunte Körbe aus Elefantengras, in tagelanger Handarbeit geflochten: Auf den Märkten rund um die Mercator-Station in Nairobi, Kenia, begegnete Rim Melake diesen kunstvollen Handwerksstücken immer wieder. Sie wunderte sich: Warum schaffen es die wunderschönen Körbe nicht nach Europa? Sie sprach mit den Produzentinnen: Die kenianischen Frauen berichteten, dass ihnen Kontakte und digitale Fähigkeiten fehlten, um Vertriebskanäle aufzubauen. Gemeinsam mit der Mercator-Kollegiatin Felicia Siegrist gründete Melake das Sozialunternehmen Kusuka. „Wir unterstützen Frauen aus Kenia, Ghana und Uganda dabei, ihr Kunsthandwerk nach Europa zu bringen.“
Schon seit ihrem Studium der Politikwissenschaft in Frankfurt am Main ist Rim Melake die praktische Umsetzung ihrer theoretischen Forschung wichtig. „Meine Herzensangelegenheit ist es, die Teilhabe von vulnerablen Gruppen zu fördern, vor allem von Frauen“, erzählt sie. Sie selbst war die Erste in ihrer Familie, die studierte. 1991 in Eritrea geboren, kam Rim Melake als Kleinkind mit ihrer Familie nach Deutschland. An der Uni brauchte sie als Arbeiterkind mit Migrationsbiografie einige Zeit, um sich zurechtzufinden. Bis heute unterstützt sie deshalb junge Menschen aus nicht akademischen Familien beim Zugang und bei der Bewerbung um Ausbildungsstellen, Stipendien und Jobs.
Nach dem Grundstudium sammelte Rim Melake Arbeitserfahrung, unter anderem beim Deutschen Institut für Menschenrechte, bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und beim UN World Food Programme. Schnell entstand der Wunsch, sich auch im Masterstudium auf Entwicklungszusammenarbeit und internationales Management zu fokussieren. Die Fragestellung ihrer Masterarbeit an der Mailänder Università Bocconi – die Wirkung von Acceleratoren auf die internationale Entwicklungszusammenarbeit – konnte sie als Mercator-Geförderte weiter untersuchen. Das führte sie zu ihrem jetzigen Job: Bei der Weltbank entwickelt Rim Melake Programme, die die digitale und finanzielle Inklusion von Frauen in den Partnerländern fördern. „Mein jetziger Job bringt zusammen, was mich in den vergangenen Jahren beschäftigt hat.“
Sheena Anderson: Aktivistin für Diversität in der internationalen Zusammenarbeit
(geboren 1991, Kollegjahrgang 2020–2021)
Sheena Anderson wuchs in den 1990er-Jahren in einem 1000-Seelen-Dorf auf der Schwäbischen Alb auf – als „Schwarze Tochter einer alleinerziehenden weißen Mutter“, so Anderson. Aus Angst vor Ausgrenzung und Ablehnung sei sie als Kind sehr schüchtern gewesen, erinnert sie sich. Erst als eine Lehrerin sie dazu überredete, Klassensprecherin zu werden, traute sie sich, ihre Stimme zu erheben. „Das war die erste Möglichkeit, mich für andere einzusetzen.“ Diese positive Bestätigung brachte sie dazu, sich vermehrt Themen wie Rassismus, Feminismus und Diversität zuzuwenden.
In Bremen studierte Sheena Anderson Internationales Politikmanagement. Anschließend sammelte sie Berufserfahrung in der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg, ehe sie sich im Masterstudium in Tübingen auf Friedensforschung und Internationale Politik spezialisierte. Eine Professorin machte sie auf das Mercator-Programm aufmerksam: „Erst wollte ich mich gar nicht bewerben, weil ich mit Blick auf vergangene Geförderte dachte, es wäre nichts für mich“, erzählt Anderson. „Dann reichte ich in letzter Minute doch noch eine Bewerbung ein.“
Als Mercator-Kollegiatin setzte sich Sheena Anderson mit intersektionalen Perspektiven auseinander. Es geht ihr darum, die Hörbarkeit marginalisierter Stimmen zu fördern. „Das Feld der internationalen Politik ist unglaublich weiß und elitär“, berichtet sie. Eine ihrer Stationen verbrachte sie in Los Angeles beim Kollektiv „Intersectional Environmentalist“, das sich für mehr Gleichheit und Diversität in der Klimagerechtigkeitsbewegung einsetzt. Außerdem sammelte sie Erfahrung im Centre for Feminist Foreign Policy, für das sie bis heute als Programmmanagerin für die Bereiche Klimagerechtigkeit und Antirassismus arbeitet.

„Das Mercator-Jahr hat mir viele Türen geöffnet“, rekapituliert Sheena Anderson. „Ich habe mir Wissen über Organisationen und institutionelles Denken angeeignet.“ Das Jahr habe sie aber auch in ihrem politischen Standing und ihrer Haltung bestärkt, sagt Anderson selbstbewusst. „Meine und andere marginalisierte Perspektiven dürfen nicht mehr überhört und übersehen werden.“
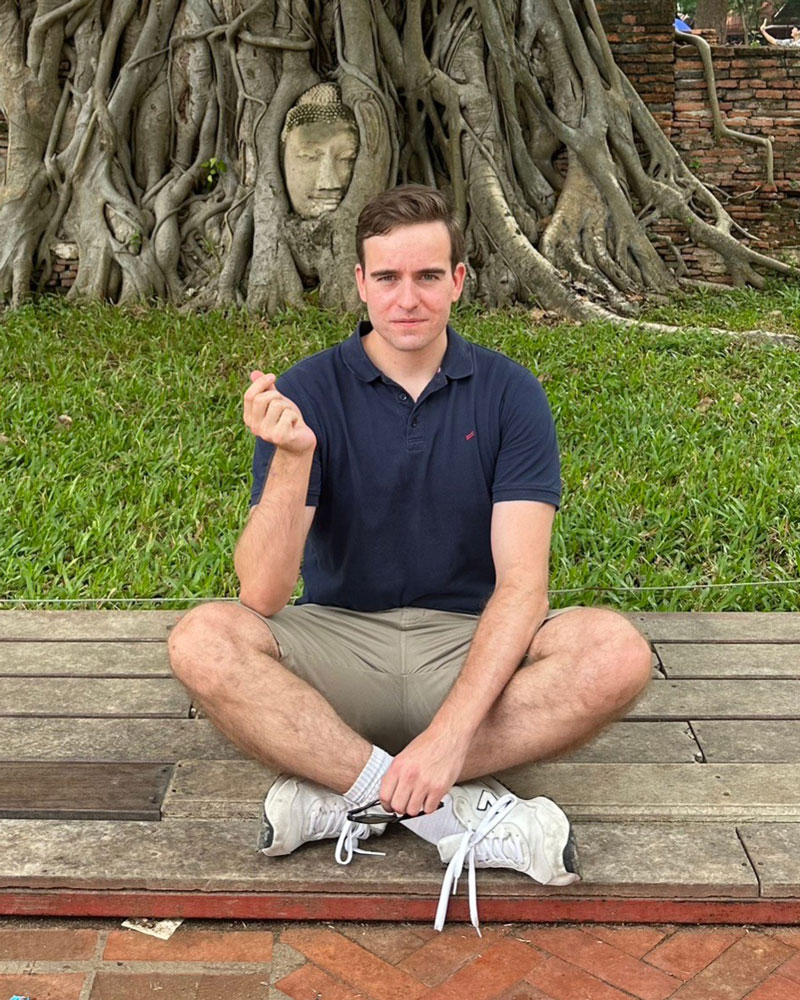
Timothy Randall: Wirtschaftsversteher und Netzwerker
(geboren 1996, Kollegjahrgang 2022–2023)
Timothy Randall sitzt in einem Londoner Büro und schaut auf die Themse. Er ist Analyst für die European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) – und kümmert sich dort um sein Herzensthema: Blended Finance. Er beschäftigt sich mit der Frage, wie der strategische Einsatz von öffentlicher Entwicklungsfinanzierung private Kapitalflüsse in Entwicklungs- und Schwellenländern fördern kann.
Auch in seinem Mercator-Kollegjahr untersuchte er, inwiefern Blended Finance dazu beitragen kann, die Wirtschaft in Schwellenländern grüner zu machen – erst als Visiting Fellow am Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment der London School of Economics and Political Science, später als Secondee bei der Asian Development Bank in Bangkok, Thailand. Dort gefiel es ihm so gut, dass er seinen Aufenthalt sogar verlängerte. Hinter seine Fragestellung „Blended Finance for Future?“ würde er heute ein Ausrufezeichen setzen. „Es gibt einen immensen Investitionsbedarf, der nicht allein durch Entwicklungsfinanzierung gedeckt werden kann. Blended Finance könnte diese Finanzierungslücken schließen.“
Timothy Randall wurde 1996 in Sachsen geboren. „Ich habe mich immer schon für wirtschaftliche Zusammenhänge interessiert.“ Während seines BWL-Studiums in Tübingen trat er der FDP bei, engagierte sich in der Hochschulpolitik. Auf Empfehlung eines Parteikollegen entschied er sich für einen Doppelabschluss im Bereich der internationalen Wirtschaftspolitik. An der Sciences Po in Paris und der Mailänder Università Bocconi lernte er neben volkswirtschaftlichen Inhalten, wie die öffentliche Verwaltung strukturiert ist und wie internationale Organisationen funktionieren.
Das Jahr der Mercator-Förderung kann er anderen nur empfehlen. „Es ist ein unglaubliches Privileg, so flexibel an einer Fragestellung arbeiten zu können.“ Neben der finanziellen Förderung und den Softskill-Workshops zu Themen wie Kommunikation, Verhandlungstechnik oder Auftreten schätzte Timothy Randall insbesondere den inhaltlichen Austausch mit den anderen Stipendiat*innen. „Ob Migration oder Wirtschaft – durch die Vielfalt an Themen nimmt man unglaublich viel mit.“
Hayam Mohseni: Fachfrau für internationale Sicherheit
(geboren 1997, Kollegjahrgang 2023–2024)
Im Oktober 2021 stapelten sich auf Hayam Mohsenis Schreibtisch Aufgaben mit politischer Brisanz. Anderthalb Monate zuvor hatten die Taliban die Macht in Afghanistan übernommen, nun wertete die Praktikantin in der Zentrale der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Berichte über die Situation in Afghanistan aus: Was war in der Afghanistan-Politik fehlgelaufen – und was lässt sich aus den Fehlern lernen?
„Unglaublich intensiv“ seien die ersten Monate nach der Machtübernahme gewesen, erinnert sich Hayam Mohseni heute. Obwohl sie bei der GIZ als Praktikantin eingestiegen war, durfte sie schnell Verantwortung übernehmen. Als wenige Monate später bei der GIZ ein eigenständiges Beratungsprojekt zu Afghanistan startete, war schnell klar, dass Hayam Mohseni als Politikberaterin einsteigen würde.

Sie kam 1997 in München zur Welt. Ihre Eltern stammen aus Afghanistan, wuchsen aber im Iran und in Syrien auf. „Meine Geschwister und ich sind dreisprachig aufgewachsen“, berichtet Hayam Mohseni. Neben Deutsch wurde zu Hause zudem Farsi und Arabisch gesprochen. Mit ihrer Familie reiste sie auch nach Afghanistan. „Für mich waren das sehr wertvolle Erfahrungen“, so Mohseni. „Aber es war auch ein Kulturschock, ich wuchs ja in Deutschland auf.“
An der Ludwig-Maximilians-Universität München studierte Mohseni Politikwissenschaften und spezialisierte sich im Master an der Sciences Po und der London School of Economics and Political Science auf internationale Sicherheit. „Mich beschäftigt die Frage, inwiefern wir in der internationalen Gemeinschaft lernfähig sind“, so Hayam Mohseni. An vielen Orten gebe es ähnliche Herausforderungen wie in Afghanistan – ob in Syrien, im Jemen oder Sudan. Im Kollegjahr will sie sich der Frage widmen, wie internationale Akteur*innen in Krisensituationen vorhandenes Wissen effektiver nutzen können, insbesondere auch wissenschaftliche Empfehlungen. Sie erhofft sich von diesem Jahr vor allem Austausch mit Gleichgesinnten: „Krisenkontexte sind oft sehr männlich und von älteren Menschen geprägt“, berichtet Mohseni. Das will sie verändern.
Mercator Kolleg
Das Mercator Kolleg für internationale Aufgaben ist ein gemeinsames Projekt der Studienstiftung und der Stiftung Mercator. Es fördert jährlich 25 engagierte deutschsprachige Hochschulabsolvent*innen und junge Berufstätige aller Fachrichtungen, die für unsere Welt von morgen Verantwortung übernehmen.
Ab 2025 werden erstmalig jährlich 20 Stipendien an berufserfahrene Changemaker*innen, Transfermeister*innen und Strategieentwickler*innen aller Fachbereiche und Branchen vergeben.
